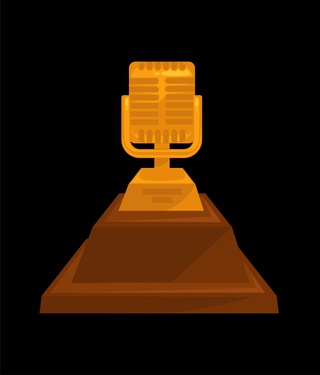Die Fenster sind offen, die Verdecke aufgeklappt, das tragbare Radio ist immer mit dabei, und Musik liegt in der Luft. Sommerhits, um genau zu sein. Sie sind eher gemächlich, einfacher Beat, eingängige Melodie. Tanzbar müssen sie sein, Urlaubstimmung verbreiten. Man taucht in sie hinein wie in den Pool seines Ferien-Ressorts und schwelgt in Erinnerungen an die Parties unter freiem Himmel mit Blick auf Palmen und Meer. Wie kommt es, dass wir sie einen ganzen Sommer lang rauf und runter hören, um sie dann im Herbst zu den Urlaubserinnerungen zu legen?
Die Fenster sind offen, die Verdecke aufgeklappt, das tragbare Radio ist immer mit dabei, und Musik liegt in der Luft. Sommerhits, um genau zu sein. Sie sind eher gemächlich, einfacher Beat, eingängige Melodie. Tanzbar müssen sie sein, Urlaubstimmung verbreiten. Man taucht in sie hinein wie in den Pool seines Ferien-Ressorts und schwelgt in Erinnerungen an die Parties unter freiem Himmel mit Blick auf Palmen und Meer. Wie kommt es, dass wir sie einen ganzen Sommer lang rauf und runter hören, um sie dann im Herbst zu den Urlaubserinnerungen zu legen?
Einen Sommerhit kann man nicht planen – oder doch?
Einer Studie der University of Huddersfield in Großbritannien zufolge gibt es eine stereotype Formel, die den perfekten Sommerhit entstehen lässt. Danach gibt es den so genannten „Ohrwurm-Quotienten“ („Catchiness Quotient“), der sich aus verschiedenen Variablen zusammensetzt. Dazu zählen höchst wissenschaftliche Zutaten wie etwa die Entfernung von Halbtönen zum höchsten und niedrigsten Ton im Refrain, die Anzahl der verwendeten Akkorde, Anzahl der Schritte in einer Tanzabfolge oder, ganz profan, die Aufwendungen für das Marketing durch die Plattenfirma. Der Quotient bestätige, so die Studie, dass es eine Formel für das Phänomen eines Sommerhits gebe und warum aus musikwissenschaftlichen Gründen in beinahe jedem Sommer die Hitparaden durch derart eingängige und einprägsame Songs überfallen würden. Die Studie lässt allerdings offen, ob alle von ihr untersuchten Sommerhits diesem Schema folgen und ob die Käufer von Tonträgern ihr Kaufverhalten danach richten.
Kalkulierter Ohrenschmaus
Sicher ist, Sommerhits sind tatsächlich wenig innovativ. Denn sie sollen milliardenfach gehört werden. Dafür folgen sie bestimmten kompositorischen Mustern. Dass den Namen des Interpreten am Anfang des Sommers noch niemand kennt, passiert dabei immer wieder, ist unter Umständen sogar ebenfalls hilfreich. Newcomer können sich vielleicht noch am besten auf das einstellen, was zu einem Sommerhit gehört: Latino-Flair, Lebensgefühl, Spaß, leicht bekleidete Mädchen im Video. Die Platten der Großen kommen ohnehin erst wieder im August. Und die etablierte Prominenz macht lieber selbst Urlaub. So entsteht ein Sommerloch, das die Newcomer mit ihren Sommerhits füllen können.
Finanzkräftig unterstützt von der Plattenindustrie. Sie beschäftigt längst spezielle Promo-Agenturen, die die Kneipen, Clubs und Diskos und Radiostationen auf Mallorca und Ibiza mit den Sommerhit-Kandidaten beliefern. So wird der Song zum Souvenir, zum Ohrwurm, den man sich aus dem Urlaub mitbringt. Die Platte kauft man dann zu Hause. Ein Re-Import gewissermaßen. Das Budget dafür kann man übrigens mit etwas sommerlichem Glück auf Sportwetten PayPal gewinnen.
Traditionell erscheinen nur die wenigsten Sommerhits wirklich im Sommer, sondern meist schon einige Monate vorher, nicht selten sogar bereits im Vorjahr. So haben die Tracks genug Zeit, sich im Trommelfell warm zu grooven.
Ohrwurm von Eintagsfliege
So entsteht aus dem Zusammenspiel sommertypischer Songs und einem intensiven Rundfunkairplay die Hochsaisonfür die Popmusik, wenngleich auch nicht gerade die hohe Kunst des Pop.
Der Sound etwa im letzten Jahr – wieder mal: Latin-Pop, Reggaeton, irgendwie karibisch. Es bleibt ungenau. Und nervt auch manchmal. Die gute Laune von Despacito klingt so kalkuliert, manch einer möchte fast gähnen. Und damit reiht sich der Hit von Louis Fonsi ein in die lange Liste von bekannten Hits weniger bekannter Interpreten.
Den Anfang macht der wohl erste Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 1959 von einem gewissen Brian Hylands. Den kennt wohl niemand mehr, aber seinen Sommerhit schon: Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini, der über eine Million Mal verkauft wurde. Die ersten Sommerhits hatten somit auch mit dem Sommer zusammenhängende Themen zum Inhalt, was jedoch später nicht immer der Fall war.
Als einer der erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten gilt In the Summertime von Mungo Jerry, der am 22. Mai 1970 veröffentlicht wurde und mindestens sechs Millionen Mal verkauft worden ist. Er verwirklicht alle Anforderungen an einen Sommerhit: textlich auf den Sommer bezogene Freizeitinhalte, tanzbarer Rhythmus, eingängige Melodie, rechtzeitige Veröffentlichung und Rang Nummer eins der Hitparaden in 26 Ländern. Auch Lou Begas Mambo No. 5 von 1999 gehört in die Kategorie der umsatzstärksten Sommerhits.
Diese Rechnung geht zwar nicht immer auf, aber immer wieder mal. Inzwischen auch im Winter. Seit der Urlaub im Schnee ebenfalls zur Ballermann-Party aufgepeppt wurde, arbeiten die Plattenfirmen an den Songs zum Grölen auf der Alm. Das Ergebnis heißt zum Beispiel Anton aus Tirol und kommt von DJ Ötzi.
Bildrechte: © iko – Fotolia.com